Das Warten hat ein Ende: Am 7. Februar veröffentlichen die Punk-Rock-Legenden Green Day ihr 13. Studioalbum. Wir haben „Father Of All …“ auf Herz und Nieren geprüft, bevor das Trio aus Kalifornien ihre neuen Songs und altbewährte Hits auf großer Welttournee auch in Deutschland präsentiert.
Where have all the riot’s gone? Wo sind die ganzen Aufstände hin, fragten Green Day 2004 in ihrem Song „Letterbomb“. Wer hätte gedacht, dass dem Hörer genau diese Frage 16 Jahre später in den Sinn kommt. „Letterbomb“ war Teil des Grammy-prämierten Albums „American Idiot“. Der gleichnamige Titelsong und weitere Single-Auskopplungen wie „Boulevard of Broken Dreams“, „Holiday“ und der Bohemian-Rhapsody-artige Fünfakter „Jesus of Suburbia“ erfreuten das Rock-Herz, und für die internationalen Mainstream-Radiostationen griffen die US-Amerikaner mit „Wake Me Up When September Ends“ zu sanfteren Tönen.
Also, wo sind die Aufstände hin? Musikalisch sind sie definitiv mit auf dem neuen Werk „Father Of All …“ (wobei „…“ abseits amerikanischer Zensurbehörden getrost mit „Motherfuckers“ ausgetauscht werden kann) gelandet. Bei der ersten Singleauskopplung „Father Of All …“ muss der Hörer keine drei Sekunden warten, bis sich das Trio mit harten Riffs aus dem fast vierjährigen Dornröschenschlaf rockt. Es folgt ein zweieinhalbminütiges melodisches Feuerwerk, hinterlegt mit einem ansprechenden Musikvideo. Es fehlt: Die auch nur ansatzweise klar herauszuhörende Stimme von Leadsänger Billie Joe Armstrong.
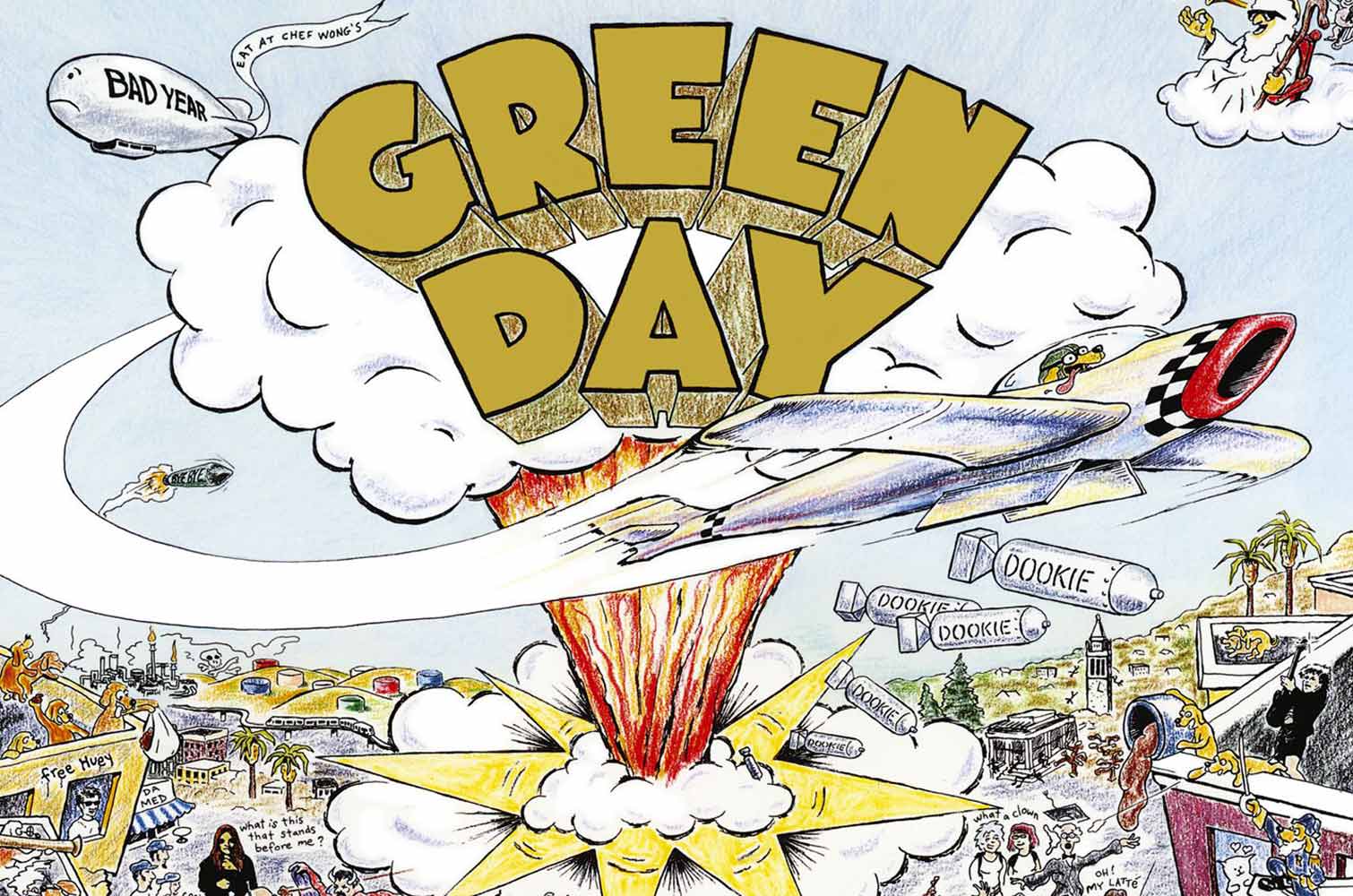
Ohrwurm-Potenzial
Die zweite vorab releaste Single „Fire, Ready, Aim“ bietet kein schnell geschnittenes Musikvideo. Muss es auch nicht, denn nach den ersten Akkorden der E-Gitarre haben Fans der Band aus Berkeley sowieso direkt den Mega-Hit „American Idiot“ vor Augen. Zu ähnlich ist der aufgesetzte Effekt am Anfang, bevor Armstrong den Hörer ins jetzt und hier holt und die tägliche Übertreibung („Baby got the hyperbole“) anprangert. Das eingängige Lied bietet definitiv Ohrwurm-Potenzial, ist inhaltlich allerdings recht dünn aufgestellt und nach nicht einmal zwei Minuten ist der Spaß auch schon wieder vorbei.
Anders beim dritten vorab erschienen Song „Oh Yeah!“. Rund drei Minuten lang legt die Band den Finger in die Wunde der Schattenseiten der Digitalisierung: Die zunehmende Selbstdarstellung auf den sozialen Netzwerken („I’m just a face in a crowd of specators“), die den Punk-Rockern naturgemäß nicht gefallen kann. Bildstark unterstützt von der ausgezeichneten Arbeit der Regisseurin Malia James, die bereits mit Rita Ora oder Bishop Briggs zusammenarbeitete. Dem Song fehlt eigentlich nur eins: Ein paar längere Passagen mit der unverstellten Stimme Armstrongs, die sich auch hier ziemlich oft hinter dem Computer versteckt – welch eine Ironie.

Kurzweilig, aber etwas fehlt
So zieht sich ein gemischtes Bild durch die zehn Songs von „Father Of All…“. Die kurzweiligen Lieder knüpfen an alte Hits an, gehen aber gleichzeitig mit dem Selbstanspruch ins Rennen, ein neues Kapitel aufzuschlagen. Der Sound der Musik stimmt, der thematische Ansatz auch – inspiriert wurde die Band laut eigener Aussage von den Sorgen der Arbeiter in den USA, die aufgrund von Arbeitsplatzverlusten und Gentrifizierung „sehr verzweifelt mit ihrer Situation geworden sind.“ Soweit alles typisch Green Day.
Doch es gibt auch ein Aber: Die Stimme von Billie Joe Armstrong ist nicht mehr so präsent wie bei den vorangegangenen Hits à la „Basket Case“. Ist der Frontmann etwa alt geworden? Oder erfindet sich die Band nach über drei Jahrzehnten grundlegend neu? Es wäre schade, Armstrong nur noch durch einen Filter zu hören, da seine Stimme immer etwas raues, verwegenes, punkiges in sich trug. Wie ein gesungener Aufstand. Where have all the riots gone?







 Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.
Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.